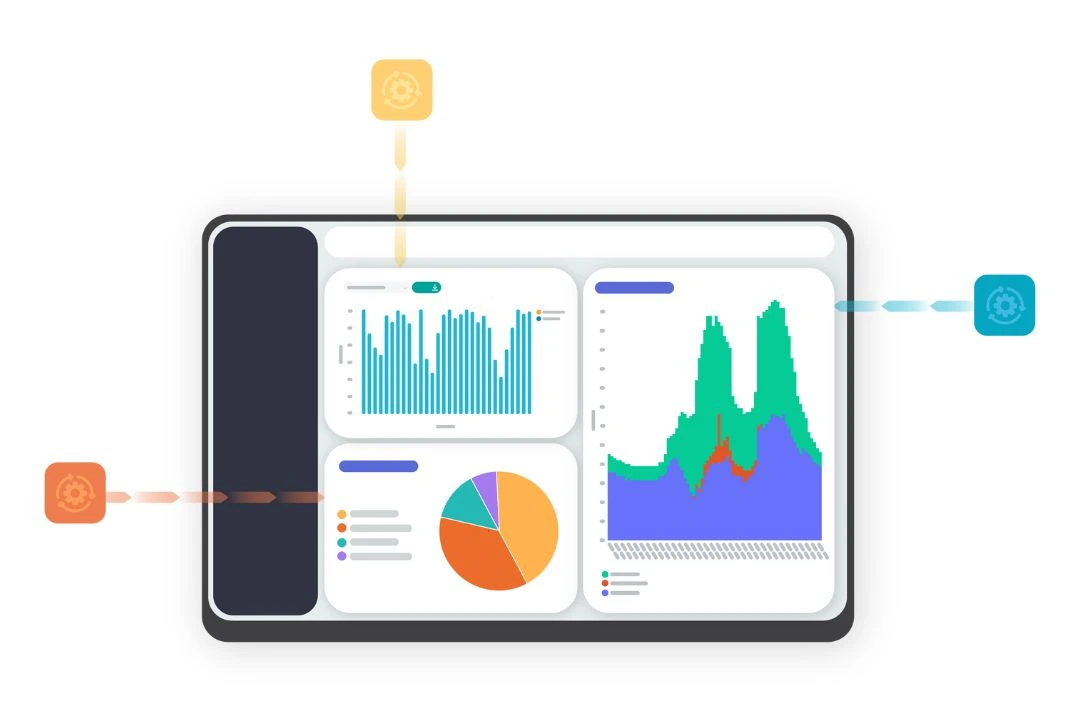Obwohl das Osterpaket bereits im letzten Jahr umgesetzt wurde, gibt es eine Änderung, die erst jetzt Wirkung entfaltet. Denn fast unbemerkt wurde § 6 EEG geändert. Die Regelung betrifft die finanzielle Beteiligung von Kommunen an Wind- und Solarparks, die nun auch für Bestandsanlagen gilt. In diesem Artikel klären wir, wie Anlagenbetreiber am besten mit der finanziellen Beteiligung von Kommunen umgehen und welche Punkte in einen Beteiligungsvertrag gehören.
§ 6 EEG – was steckt drin?
Die Hauptaussage von § 6 EEG ist, dass Betreiber von Wind- und PV-Freiflächenanlagen angrenzende Kommunen an den Gewinnen aus der Stromerzeugung beteiligen sollen. Wenn sich Anlagenbetreiber an die im Paragrafen festgelegten Einschränkungen halten, können sie mit der Hilfe von finanziellen Mitteln für mehr guten Willen bei den Kommunen sorgen, ohne dass dies als Bestechung ausgelegt werden kann. So erhofft sich der Gesetzgeber von § 6 EEG, dass die Akzeptanz von on-shore Windanlagen und Freiflächen-PV-Anlagen in Städten und Gemeinden steigt.
Folgende Voraussetzungen gelten für die finanzielle Beteiligung von Kommunen:
- Betreiber dürfen maximal 0,2 Cent pro erzeugter oder fiktiver Kilowattstunde an die Kommune zahlen.
- Die Beteiligung von Kommunen gilt nur für Windkraftanlagen an Land ab 1 MWp installierter Leistung und Freiflächensolaranlagen jeglicher Leistung.
- Betroffen sind Gemeinden, die sich innerhalb eines Radius von 2,5 km um eine Windanlage befinden. Bei Freiflächenanlagen gilt, dass Kommunen beteiligt werden können, wenn auf deren Gebiet die Anlage ganz oder teilweise errichtet wurde.
- Gibt es mehrere betroffene Gemeinden, müssen Anlagenbetreiber entweder allen Kommunen eine Beteiligung anbieten – oder keiner. Bei der Beteiligung mehrerer Kommunen gilt, dass sie entsprechend ihres Anteils am betroffenen Gebiet beteiligt werden. Befindet sich der Radius einer Windkraftanlage also zu 1/3 im Gebiet der Kommune A und zu 2/3 im Gebiet der Kommune B, erhält Kommune A 1/3 der 0,2 ct/kWh (oder weniger, je nach vereinbartem Betrag) und Kommune B 2/3.
- Bei mehreren beteiligten Kommunen müssen die Anteile für jede Windkraftanlage berechnet werden.
- Handelt es sich bei der Umgebung um gemeindefreies Gebiet, so gilt der Landkreis als betroffen. Auch Landkreise können finanziell beteiligt werden.
- Verträge über eine Beteiligung können auch abgeschlossen werden, bevor die Anlage genehmigt wurde. Bei Freiflächenanlagen muss aber der Bebauungsplan für die gewählte Fläche bereits beschlossen sein.
- Die ausgezahlten Beteiligungen können Anlagenbetreiber von ihrem zuständigen Netzbetreiber erstattet bekommen, sofern sie für die zugrunde liegenden Strommengen eine EEG-Förderung erhalten haben.
Warum werden Kommunen jetzt darauf aufmerksam?
Bis zur Einführung des Osterpakets galt § 6 EEG nur für neu errichtete Anlagen. Die Idee dahinter war, die Akzeptanz der EE-Anlagen zu erhöhen und für Kommunen einen Anreiz zu schaffen, die Errichtung in der Nähe ihrer Gebiete zu erlauben. Seit dem 1. Januar 2023, sind nun auch Bestandsanlagen in den Paragrafen aufgenommen.
Eine nicht bindende, aber doch recht bedeutungsschwere Änderung wurde direkt im ersten Satz vorgenommen. Dort hieß es erstmalig „Folgende Anlagenbetreiber dürfen […]“, dies wurde nun geändert zu „Anlagenbetreiber sollen […]“. Weiterhin ist dies nicht bindend, macht aber doch deutlich, dass der Gesetzgeber sich eine Beteiligung der Kommunen an den Einnahmen aus der Stromerzeugung wünscht.
Vorteile von § 6 EEG für Betreiber
Nach eigener Angabe hat der Gesetzgeber § 6 im EEG verankert, um die Akzeptanz von on-shore Windanlagen zu steigern, später wurde dies um Freiflächenanlagen erweitert. Die Idee dahinter ist, dass Anwohner und Bürgermeister nicht gegen eine Windanlage aufbegehren, wenn die Einnahmen aus dem erzeugten Strom zum Beispiel auch in die Instandhaltung des Spielplatzes und die Erweiterung der Gemeindebücherei fließen.
Vor den Änderungen durch das Osterpaket war die Beteiligung nur für neue Anlagen vorgesehen. Jetzt können Betreiber die Errichtung neuer Anlagen nochmal attraktiver machen, wenn sie gleichzeitig Bestandsanlagen in die Beteiligung aufnehmen. Gleichzeitig können Betreiber darauf hoffen, dass die Planungsphasen beschleunigt werden, wenn ein Eigeninteresse an der Inbetriebnahme einer Anlage besteht.
Bestimmt haben sich einige Betreiber auch anderweitig mit den anliegenden Kommunen geeinigt, nun erhalten diese manchmal unumgänglichen Absprachen einen geregelten Rahmen und den Stempel der Legalität. Auf der anderen Seite ist zu bedenken: die Kommunen haben kein Recht auf die Beteiligung. Anlagenbetreiber bestimmen frei, ob und wie viel (im Rahmen des Gesetzes) sie die Kommunen beteiligen möchten.
Worauf sollten Anlagenbetreiber bei der Vertragsgestaltung achten?
Abgesehen von den Einschränkungen, wann und wo eine Beteiligung möglich ist, gibt § 6 EEG keine Rahmenbedingungen für die Verträge zwischen Kommunen und Betreibern vor. Erste Musterverträge wurden bereits aufgesetzt, etwa von der Kanzlei Becker Büttner Held für den Deutschen Städte- und Gemeindebund und die Fachagentur Windenergie an Land sowie von der Kanzlei Bredow Valentin Herz für den Bundesverband Solarwirtschaft e. V. Allerdings ist zu beachten, dass Bundesländer zusätzliche Regeln zu § 6 EEG aufgestellt haben können, die bei der Vertragserstellung beachtet werden müssen.
Nicht jeder dieser Musterverträge hat dabei die Interessen der Betreiber an einer effizienten und klar geregelten Beteiligung gleichermaßen berücksichtigt. Daher gilt: Ob Mustervertrag, Vorschlag der Kommune oder eigenes Rechtswerk, diese Punkte sollten auf jeden Fall in einem Beteiligungsvertrag geklärt werden:
Zahlungszeitraum
Im Vertrag sollten Anlagenbetreiber festlegen, bis wann sie den Kommunen ihre Beteiligung überweisen. Aus unserer Sicht ist ein Abrechnungszeitraum vom 01.11. bis 30.10. des Folgejahres praktikabel, mit Zahlung zum 15.12. Das lässt Anlagenbetreibern genug Zeit, die Strommengen und Beteiligungen zu berechnen, zu bezahlen und die Rückerstattung beim Netzbetreiber (bis zum 28.02.) zu beantragen.
Betroffene Mengen
Ein wichtiger Punkt, der vertraglich geklärt werden muss, ist, ob Anlagenbetreiber Kommunen nur an den tatsächlich eingespeisten Strommengen oder auch an fiktiven Mengen beteiligen. Fiktive Mengen fallen an, wenn eine Anlage im Zuge einer Redispatch 2.0-Maßnahme oder vom Direktvermarkter abgeregelt wurde oder wenn die Nichtverfügbarkeit der Anlage 2 % des Bruttostromertrages überschreitet.
Dem Anlagenbetreiber werden zwar Strommengen zugeschrieben, die die Anlage in dieser Zeit erzeugt hätte und auch vergütet. Nach unserer Erfahrung liegen aber lange Wartezeiten zwischen dem Abregeln der Anlage und der Information, wie viel Strom dem Betreiber gutgeschrieben wird. In diesem Fall kann der zuvor vereinbarte Zahlungszeitraum nicht eingehalten werden. Zusätzlich ist zu bedenken, dass die Zahlungen für fiktive Strommengen nicht zurückerstattet werden. Da Anlagenbetreiber aber relativ frei in der Vertragsgestaltung sind, können Sie mit den Kommunen vereinbaren, diese nur an den tatsächlich eingespeisten Strommengen zu beteiligen.
Für Betreiber von Freiflächensolaranlagen ist dieser Punkt einfacher. Sie können Kommunen standardmäßig nur an den tatsächlich eingespeisten Mengen beteiligen.
Vertragslaufzeit
Bei der Vereinbarung der Vertragslaufzeit muss ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Kommunen und der Anlagenbetreiber gefunden werden. Für Kommunen ist eine lange Vertragslaufzeit, etwa zehn Jahre, von Vorteil, wohingegen Anlagenbetreiber mit einer kürzeren Laufzeit besser auf Änderungen reagieren können, wie zum Beispiel das Auslaufen der EEG-Förderung, oder die In- und Außerbetriebnahme von Anlagen.
Kündigungsmöglichkeit
In den Musterverträgen der Anwaltskanzleien Becker Büttner Held und von Bredow Valentin Herz wird den Kommunen ein Kündigungsrecht zu jedem Monatsende eingeräumt. Für Betreiber dagegen gibt es kaum Kündigungsrechte. Dies soll verhindern, dass Kommunen die Verträge ablehnen, da sie fürchten, dass die Betreiber kurze Zeit nach Genehmigung der Anlagen aus der Beteiligung austreten. Dennoch sollten Betreiber auf einige Kündigungsgründe für sich bestehen, dazu gehören:
- Eine Kündigung sollte möglich sein, falls § 6 EEG als verfassungswidrig eingestuft wird oder nicht mit dem Europarecht vereinbar ist.
- Eine Kündigung von Seite des Betreibers ist möglich, wenn sich das Gemeindegebiet ändert.
- Außerdem sollten Betreiber den Vertrag aufkündigen können, wenn die wirtschaftliche Lage sich zum Negativen verändert und die Beteiligung die Rentabilität der Anlage gefährdet.
Beteiligung mehrerer Kommunen
Was passiert aber, wenn die Freiflächenanlage auf dem Gebiet mehrerer Kommunen liegt, oder der 2,5 km-Radius der Windkraftanlage das Gebiet mehrerer Gemeinden schneidet? In diesem Fall müssen alle betroffenen Kommunen beteiligt werden, sofern der Anlagenbetreiber dies anbietet. Die Beteiligung erfolgt anteilig je nach betroffenem Gebiet (siehe Grafik 1).

Da Kommunen das Recht haben, eine Beteiligung abzulehnen, sollte vorher festgehalten werden, wie in diesem Falle die festgelegte Beteiligung vergeben wird. Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
- Der Betrag, der zuvor für die Gemeinde, die abgelehnt hat, vorgesehen war, wird anteilsmäßig auf die anderen Gemeinden verteilt.
Oder
- Der Betrag wird nicht ausgezahlt, der Auszahlungsbetrag für die restlichen Gemeinden ändert sich nicht.
Mitwirkungspflicht der Gemeinde
Anlagenbetreiber sollten in einem Beteiligungsvertrag die Kommunen zu einer Mitwirkung bei der Abrechnung in Form einer Abrechnungsbestätigung verpflichten. Diese Bestätigung der Zahlung an die Kommunen ist hilfreich, wenn eine Erstattung gegenüber dem Netzbetreiber beantragt wird. Noch ist nicht abschließend geklärt, welche Unterlagen Anlagenbetreiber einreichen müssen. Mit der Mitwirkungspflicht für Kommunen sind sie aber abgesichert.
Optionale Klauseln
Da die Erstattung der Beteiligungszahlung nur für die Kilowattstunden gilt, für die Betreiber eine EEG-Förderung erhalten haben, ist es prinzipiell möglich, die Beteiligung der Kommunen auf EEG-geförderte Mengen zu begrenzen. Damit dieser Punkt nicht als „Schlupfloch“ angesehen wird, kann es als auch Notfallklausel vereinbart werden, die nur greift, falls der Betreiber der Anlage von einer wirtschaftlich schwierigen Situation betroffen ist.
Wie können sich Anlagenbetreiber die Beteiligung erstatten lassen?
Anlagenbetreiber können eine Erstattung für die geleisteten Zahlungen an die Kommunen von den Netzbetreibern fordern. Das ist allerdings nur für bestimmte Strommengen möglich. Denn erstattet wird eine Beteiligung der Kommunen nur für die Kilowattstunden, die EEG-förderberechtigt sind und diese Förderung in Form erhalten haben. Anlagen in einem PPA oder in der sonstigen Direktvermarktung erhalten also keine Erstattung. Auch fiktive Strommengen sind von der Rückerstattung ausgeschlossen.
Betreiber mit EEG-förderberechtigten Anlagen müssen gegenüber ihrem Netzbetreiber nachweisen, für welche Strommengen sie die Förderung erhalten haben. Das betrifft die Strommenge, die in Zeiträumen eingespeist wurden, in denen der Börsenpreis unter dem anzulegenden Wert lag und somit die Marktprämie ausgezahlt wurde. Anlagenbetreiber müssen die Erstattung bis zum 28. Februar bei ihrem Netzbetreiber einreichen. Die Netzbetreiber erstatten die Zahlungen dann im Rahmen der Endabrechnung.
In welcher Form die Erstattung beantragt werden muss, ist allerdings noch nicht abschließend festgelegt. Eine Anwendungshilfe der Clearingstelle EEG | KWKG, die am 15. Juli 2024, veröffentlich wurde, stärkt hierbei aber Anlagenbetreibern den Rücken. Denn nach ihrer Sicht müssen zwar die notwendigen Nachweise für eine Beteiligung geliefert werden, etwa über die Höhe der zu erstattenden Zahlungen, Strommengen und eine Bestätigung der Leistung gegenüber der Gemeinde, ist allerdings nicht im EEG vorgeschrieben. Sonderwünsche der Netzbetreiber nach zusätzlichen Dokumenten bedürfen der vertraglichen Vereinbarung mit den Anlagenbetreibern.
Beteiligungsgesetze in den Bundesländern
Die kommunale Beteiligung ist im EEG für die Betreiber erst einmal auf freiwilliger Basis. Es ist den Bundesländern aber gleichzeitig freigestellt, weitere Bestimmungen festzulegen wie etwa eine verpflichtende Beteiligung.
Informieren Sie sich also am besten darüber, welche zusätzlichen Regelungen in Ihrem Bundesland gelten. Eine erste Übersicht finden Sie hier (Stand: August 2025).
Mit opti.node Cockpit kommunale Beteiligung effizient umsetzen
Sie möchten Kommunen beteiligen? Dann sprechen Sie uns an!
Mit unserer Marktführerlösung opti.node Cockpit erledigen wir die notwendigen Prozesse zur Umsetzung von § 6 EEG für Sie effizient und rechtssicher. Die genaue und transparente Berechnung der an die Kommunen zu entrichtenden Beträge erfolgt ebenso automatisiert wie die Erstellung von korrekten und vertragskonformen Abrechnungen. opti.node Cockpit unterstützt Sie ebenfalls bei der unkomplizierten Abwicklung der Anträge zur Rückerstattung bei den Netzbetreibern. Profitieren Sie vom Know-how mit Behördenmeldungen und Abrechnungen von bereits über 14.000 Wind- und PV-Freiflächenanlagen.