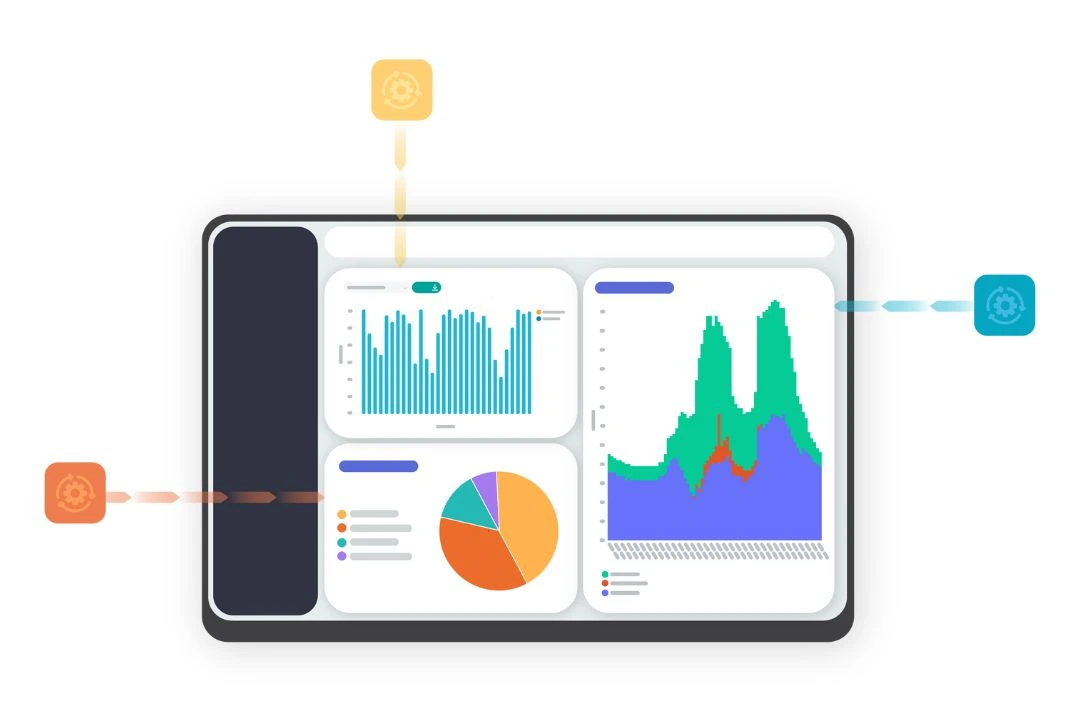Um die Nutzung von erneuerbaren Energien zu beschleunigen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren, haben einige Bundesländer eine Photovoltaikpflicht beschlossen. Diese Pflicht betrifft insbesondere Unternehmen aus Industrie und Gewerbe, die neue Nichtwohngebäude und größere Parkplätze errichten. Teilweise greift die Pflicht aber auch bei der Sanierung von Dächern von Bestandsgebäuden.
Für betroffene Unternehmen ist diese Pflicht zunächst eine zusätzliche Hürde beim Bau eines neuen Produktions-, Logistik-, oder Bürogebäudes. Doch eröffnen sich damit auch große Chancen, wie günstigeren Strom, einen Schritt zur Dekarbonisierung des Unternehmens und ein positives Image in der Öffentlichkeit.
Was ist die Solarpflicht? Wo gilt sie? Übersicht zum Stand in den Bundesländern
Die Solarpflicht bedeutet grundsätzlich, dass eine Photovoltaikanlage auf oder an einem Gebäude bzw. über den Stellplätzen eines Parkplatzes installiert und betrieben werden muss. Sie ist jedoch derzeit nicht bundeseinheitlich geregelt, sondern eine Initiative einzelner Bundesländer.
In allen Bundesländern, die bisher eine Photovoltaikpflicht beschlossen oder geplant haben, ist sie unterschiedlich ausgestaltet und setzt damit eigene Anforderungen. Die nachfolgende Tabelle stellt die derzeitigen Regelungen zur PV Pflicht in den einzelnen Bundesländern dar:
Wen betrifft die PV-Pflicht und was muss getan werden?
Die Solarpflicht der Bundesländer betrifft überwiegend Unternehmen, die neue Nichtwohngebäude errichten, wie Produktions-, Logistik oder Bürogebäude, sowie kommunale Liegenschaften. Hinzu kommt in einigen Bundesländern auch eine Solaranlagen Pflicht bei der Errichtung neuer Parkplätze. Im Bestand greifen die Vorschriften, sofern überhaupt vorhanden, nur bei größeren Umbauten am Dach, wie beispielsweise ein Dachausbau, eine Dachaufstockung oder eine grundständige Dachsanierung.
Im Folgenden einige wesentliche Eckpunkte der Photovoltaikpflicht, die in den Bundesländern voneinander abweichen können. Zum Teil sind die Details in den Bundesländern auch noch nicht abschließend geregelt, sondern werden noch per Rechtsverordnung festgelegt. Die aktuellen Anforderungen in Ihrem jeweiligen Bundesland können den Verlinkungen in oben stehender Tabelle entnommen werden.
- Vorgeschrieben ist eine allgemeine Errichtungs- und Nutzungspflicht für Photovoltaik-Anlagen für Neu- und Bestandsgebäude.
- Die Pflicht greift für Neubauten ab 2022 in Baden-Württemberg bzw. ab 2023 in den weiteren Bundesländern. Für Bestandsgebäude gilt die Pflicht frühestens ab 2023.
- Die Mindestgröße der Anlage ist unterschiedlich geregelt. Während es in Hamburg keine Vorgabe gibt, müssen die Photovoltaikanlagen bei Neubauten in Berlin mindestens 30 Prozent der Dachfläche bedecken.
- Zur Umsetzung können sich Eigentümer auch eines Dritten bedienen, die Dachfläche also z.B. verpachten.
- Teilweise (z.B. in Baden-Württemberg) darf die Photovoltaikanlage auch auf anderen Außenflächen des Gebäudes oder in unmittelbarer Nähe installiert werden.
Es gelten folgende Ausnahmen und Befreiungstatbestände:
- Widerspruch zu anderen Vorschriften, z.B. Denkmalschutz
- Technische Unmöglichkeit
- Wirtschaftliche Unvertretbarkeit
- Besondere Umstände im Einzelfall, die zu einer unbilligen Härte führen würden
- Weitgehende Belegung der Dachfläche durch eine Solarthermieanlage
Wichtig ist überdies zu prüfen, zu welchem Zeitpunkt und wie die Installation und der Betrieb der Photovoltaikanlage nachgewiesen werden muss. In der Regel erfolgt der Nachweis über eine schriftliche Bestätigung der Eintragung der Photovoltaikanlage im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur.
Möglichkeiten zur Umsetzung der Photovoltaikpflicht
Muss beim Bau eines neuen Firmengebäudes, z.B. einer Werks- oder Logistikhalle, eine Photovoltaikanlage errichtet werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Umsetzung. Grundsätzlich können Unternehmen selbst tätig werden, oder einem Dritten die Umsetzung überlassen. Entscheidend ist, welches Betreibermodell gewählt wird. Die wichtigsten Fragen, die sich Unternehmen hierzu im Vorfeld stellen müssen, sind:
- Wer soll die Anlage finanzieren? Wollen Sie z.B. selbst investieren, oder ein Dritter?
- Wer soll Betreiber der PV-Anlage werden?
- Wer soll den erzeugten Strom verbrauchen?
In Abhängigkeit von der Beantwortung dieser Fragen ergeben sich die nachfolgend kurz dargestellten Betreibermodelle:
Eigenverbrauch: Hier errichtet und betreibt das Unternehmen die PV-Anlage auf dem Gebäude oder Parkplatz selbst und verbraucht auch den erzeugten Strom vollständig oder teilweise selbst. Soll eine eigene Investition vermieden werden, kann alternativ ein Dritter/Dienstleister die Anlage finanzieren und diese dann an das Unternehmen zurück verpachten, sodass wiederum der erzeugte Strom vollständig oder teilweise vom Unternehmen selbst verbraucht wird. Der Überschuss wird ins Netz eingespeist bzw. an einen Direktvermarkter veräußert.
Die Realisierung einer Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch ist in der Regel die wirtschaftlichste Variante, da nur die Stromgestehungskosten bezahlt werden müssen. Weitere Abgaben und Umlagen fallen bei Eigenverbrauch des Stroms nicht an. Da die Stromgestehungskosten bei großen Photovoltaikanlagen heute zwischen sechs und acht Cent pro kWh liegen, ist der Solarstrom deutlich günstiger als übliche Strompreise von ca. 17 Cent pro kWh in der Industrie, bzw. 23 Cent pro kWh im Gewerbe (Stand April 2021, Monitoringbericht 2021 der Bundesnetzagentur).
Entscheidend für die wirtschaftliche Betrachtung ist daher, wie viel Strom selbst verbraucht werden kann. Je mehr Strom aus erneuerbaren Energien vor Ort verbraucht wird, umso höher ist die Einsparung. Es kann sich also auch lohnen eine größere Photovoltaikanlage zu bauen als in der Mindestanforderung gefordert.
Mieterstrom: Im Modell Mieterstrom errichtet und betreibt ein Dritter die Photovoltaikanlage auf dem Gebäude und beliefert dann mit dem erzeugten Strom im Gebäude ansässige Unternehmen und, falls vorhanden, weitere Unternehmen auf dem Betriebsgelände.
Da hier auf die Stromerzeugungskosten vom Betreiber auch eine Gewinnmarge aufgeschlagen wird, sind die Kosten somit zwar etwas höher als beim Modell des Eigenverbrauchs. Der Solarstrom ist aber immer noch wirtschaftlich, da darüber hinaus wiederum keine Abgaben, Netzentgelte und Stromsteuer gezahlt werden müssen.
Tritt im Mieterstrom-Modell der Vermieter des (Industrie-)Gebäudes als Betreiber der Photovoltaikanlage auf und beliefert die Mieter der Gewerbeimmobilie spricht man auch von „gewerblichem Mieterstrom“ oder „On-site PPA“. Im Unterschied zum Mieterstrom-Modell mit privaten Haushalten ist dieser ist aber nicht gesondert gesetzlich geregelt und der Vermieter bzw. Betreiber ist nicht dazu verpflichtet den verbleibenden Strombedarf zu liefern.
Ist das passende Betreibermodell ausgewählt, sollte die technische Planung und Ausführung, d.h. die Dachmontage der Photovoltaik Module und die Elektroinstallation, von einem spezialisierten Fachunternehmen durchgeführt werden. Zahlreiche etablierte Anbieter stehen dafür am Markt zur Verfügung.
Aufgaben für Unternehmen als Betreiber einer Photovoltaikanlage
Die Wahl des Betreibermodells ist entscheidend. Denn wer den Betrieb der Photovoltaikanlage übernimmt, der muss an einige wichtige Aufgaben und Pflichten denken. Für Unternehmen, die bislang noch keine eigenen Stromerzeugungsanlagen betrieben haben, sind diese in der Regel neu. Daher sollten sie frühzeitig in die Planung mit einbezogen werden. Eine ausführliche Beschreibung der Pflichten für Photovoltaik Betreiber haben wir bereits in einem früheren Artikel beschrieben.

Hier sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst:
- Mit der Inbetriebnahme der Anlage fällt der Eintrag in das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur an.
- Bei einer Direktlieferung des Stroms muss der Betreiber die entsprechende Versorgererlaubnis vom Hauptzollamt einholen.
- Betreiber müssen eine ordnungsgemäße Rechnung an die Drittverbraucher, z.B. Mieter, nach den Vorgaben des EnWG und StromStG stellen.
Wichtig ist es auch zu prüfen, ob die Stromversorgung mit der eigenen Photovoltaikanlage Folgen für andere Pflichten oder Privilegien in der Stromversorgung nach sich zieht.
Automatisierte Erfüllung der Betreiberpflichten
Die dargestellten Aufgaben und Pflichten können für Unternehmen zu einer Herausforderung werden, besonders wenn komplizierte Konstellationen mit mehreren Standorten und Stromabnehmern vorliegen.
Statt in teure externe Berater oder Schulungen für Mitarbeiter zu investieren, kann eine clevere Softwarelösung helfen, diese Aufgaben leicht zu bewältigen. In opti.node können die Mitarbeiter jeden Standort mit Erzeugung und Verbrauch und allen beteiligten Unternehmen digital abbilden. Die Software weiß anschließend genau, welche energierechtlichen und -wirtschaftlichen Pflichten und Meldungen anfallen und welche Rechnungen sie stellen muss. Durch die automatische Erfassung der Zähler- und Lastgangdaten kann die Software die korrekten Mengen für erforderliche Meldungen selbständig ermitteln und erstellt sogar die notwendigen Stromabrechnungen und Formulare für die Behörden.
Unternehmen können sich dank opti.node weiter auf das Kerngeschäft konzentrieren und die Erfüllung der Solarpflicht wird nicht zu einer bürokratischen Belastung. Vielmehr kann die neue Photovoltaikanlage ein Anstoß zu einer nachhaltigen Energieversorgung mit weiteren Schritten zur Klimaneutralität sein.